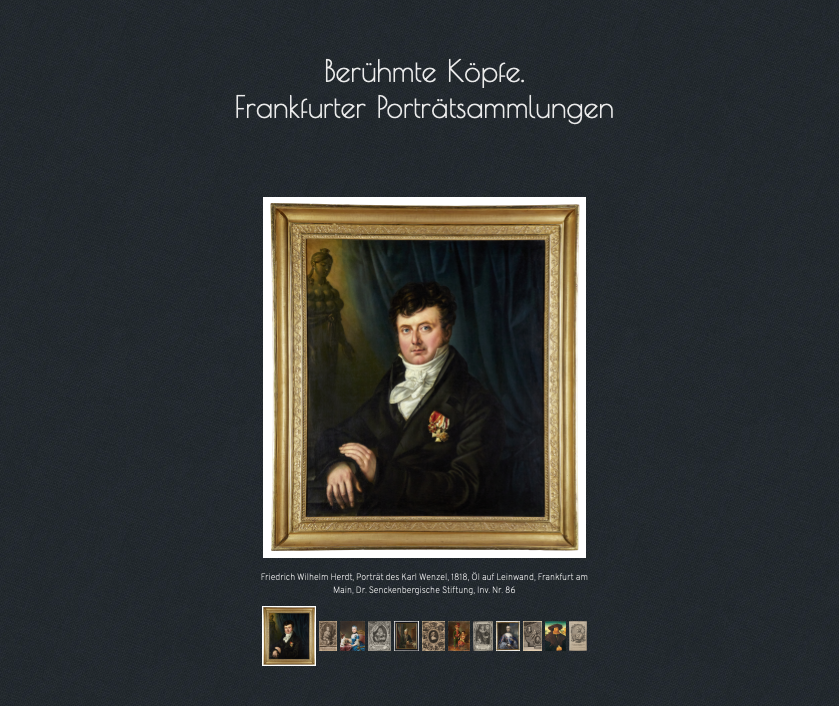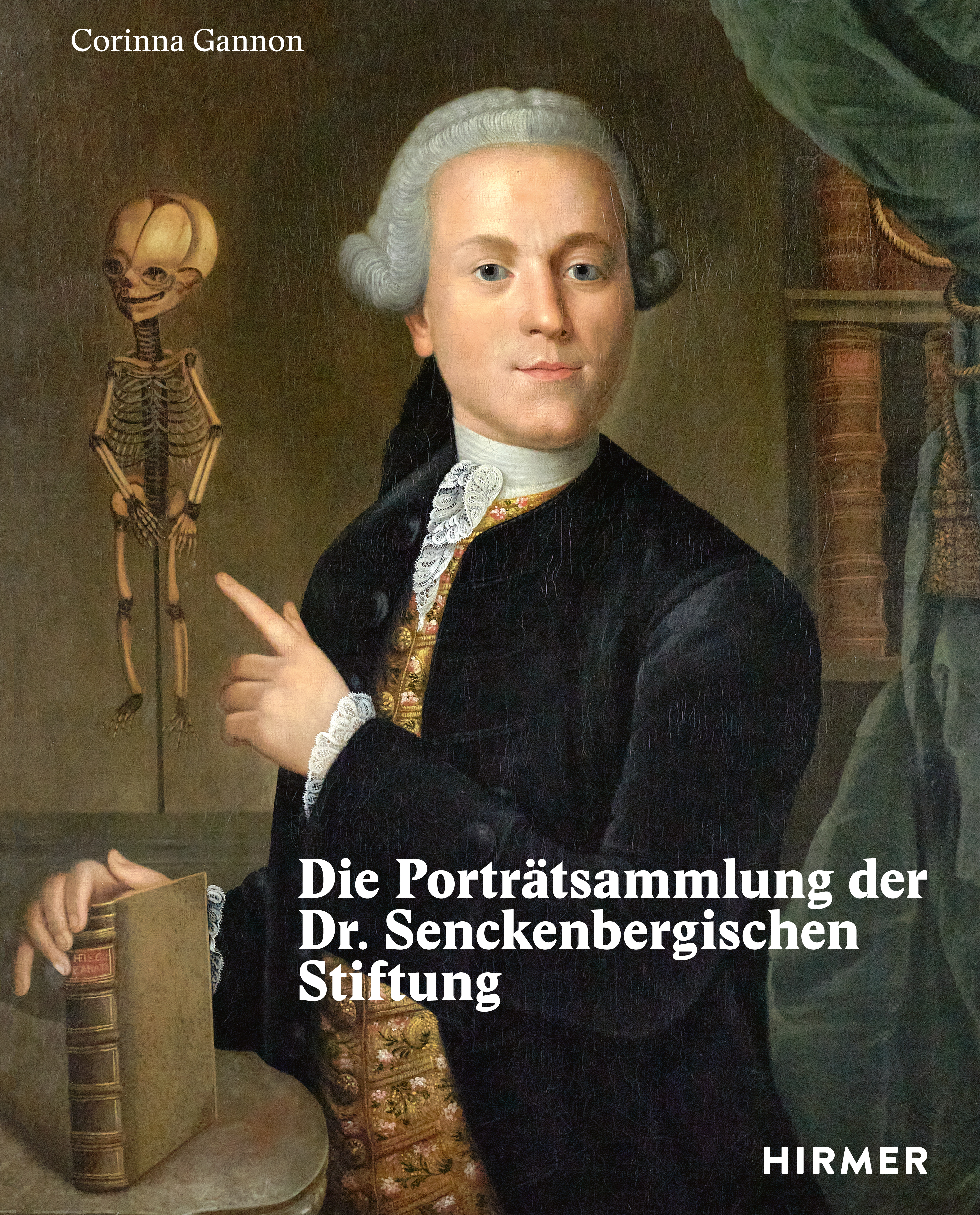Porträtsammlung der Dr. Senckenbergischen Stiftung
Bearbeitet von Corinna Gannon M.A., Städel-Kooperationsprofessur Prof. Dr. Jochen Sander, im Auftrag der Dr. Senckenbergischen Stiftung und gefördert von der Art Mentor Foundation Lucerne.
Mit der
im Jahr 1763 gegründeten Dr. Senckenbergische Stiftung strebte der
Frankfurter Arzt und Naturforscher Johann Christian Senckenberg
(1707-1772) an, die medizinische Versorgung der Bürger seiner
Heimatstadt dauerhaft zu gewährleisten und zugleich einen Ort für
Forschung und Lehre zu schaffen. Bis heute lebt die Gründungsidee des
Stifters im Bürgerhospital und in den zahlreichen nach ihm benannten
Forschungseinrichtungen weiter
(http://www.senckenbergische-stiftung.de/die-institute.html). Doch
Senckenberg war nicht nur passionierter Wissenschaftler, sondern auch
ein großer Sammler von naturalia, scientifica und artificialia. Bereits
vor der Gründung seiner Stiftung legte er eine umfangreiche
Porträtsammlung an, die neben Bildnissen seiner nächsten
Familienangehörigen auch Porträts von bedeutenden Vertretern seines
Berufstandes und anderen Gelehrten umfasste, und die über die Jahrzehnte
hinweg durch Schenkungen und Ankäufe stetig anwuchs. Die Bildnisse der
medizinischen Vorgänger und Vorbilder hatten von Beginn an eine
identitätsstiftende Funktion und sollten den Versammlungsraum des
Collegium medicum schmücken, den Mitgliedern die Genealogie ihres
Berufsstandes vor Augen führen und sie ihrer Tradition gewahr werden
lassen. Bis heute ist diese einzigartige Sammlung als Dokumentation der
Frankfurter Medizingeschichte seit dem 18. Jahrhundert erhalten
geblieben und umfasst knapp 170 Werke
(http://www.senckenbergische-portraitsammlung.de/intro.html)
Neben
den aufwendigen und teuren gemalten Bildnissen war bei Porträtsammlern
des 18. Jahrhunderts vor allem das deutlich preiswertere Medium der
Druckgrafik beliebt. Das Anlegen einer umfangreichen Bildnissammlung war
dabei nicht nur ein intellektueller Zeitvertreib, sondern zugleich Teil
eines Erkenntnisprozesses, standen die Dargestellten doch immer auch
stellvertretend für ihre jeweiligen Errungenschaften in Gesellschaft,
Politik, Kultur oder eben in der Wissenschaft. So muss auch Senckenberg
eine Porträtgrafiksammlung mit Bildnissen von Medizinern und Gelehrten
als Pendant zu seiner Gemäldesammlung angelegt haben, die heute jedoch
als verloren gilt. Allerdings hat sich eine weitere
Porträtgrafiksammlung erhalten, die auf den zweiten Stiftsarzt und
Senckenbergs Nachfolger, Georg Philipp Lehr (1756-1807), zurückgeht.
Diese heute noch knapp 1500 Druckgrafiken umfassende Sammlung hat sich
in der Universitätsbibliothek
(https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/drucke/nav/classification/10253023)
ebenso erhalten wie der dazugehörige dreibändige, von Lehr
handschriftliche verfasste Katalog
(https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/kataloge/content/titleinfo/10812721).
Lehrs bisher inhaltlich nicht erforschte Sammlung von Porträts
berühmter Mediziner und Naturforscher ist unter den vergleichbaren
erhaltenen Kollektionen nicht nur in ihrer Quantität, sondern auch in
der druckgrafischen Qualität der Drucke einzigartig und stellt zusammen
mit dem gleichfalls erhaltenen Katalog einen Glücksfall für die
Wissenschaft dar.
Ziel des auf zwei Jahre angelegten
Forschungsprojektes (2020-2022) ist es, diese beiden Porträtsammlungen
der Dr. Senckenbergischen Stiftung zu erforschen und die erarbeiteten
Inhalte nicht nur in einer Bilddatenbank zugänglich zu machen, sondern
in Auswahl auch in einer umfangreichen Buchpublikation einer breiteren
Öffentlichkeit zu präsentieren. So wird das Buch in thematisch
unterschiedlich ausgerichteten Kapiteln die Genese der Sammlungsbestände
nachzeichnen und Schlaglichter auf inhaltlich besonders reizvolle
Werkgruppen werfen. Neben den privaten Porträts des Stifters, die
zugleich das Herzstücks des Bestands bilden, sollen erstmals die
Bildnisse der Frankfurter Ärzte jüdischen Glaubens angemessen gewürdigt
werden, die eine besonders bewegte Geschichte zu verzeichnen haben.
Darüber hinaus wird die Gruppe die Ärzteporträts der Frankfurter Malerin
Ottilie Roederstein (1859-1937) näher in den Blick genommen und nach
der Rolle der Frau in der Medizingeschichte gefragt. Wo möglich wird
nach inhaltlichen Schnittstellen zwischen Gemälden und Grafiken gesucht
und somit werden erstmals zwei bedeutende Sammlungskonvolute der Dr.
Senckenbergischen Stiftung zusammengeführt, die sich gegenseitig
vielfältig bereichern.
Die Bearbeitung der Porträtgrafiksammlung
erfolgt in Zusammenarbeit mit der Bildstelle des Kunstgeschichtlichen
Instituts. Die dort beschäftigten studentischen Hilfskräfte erfassen die
Grafiken systematisch in einer ConedaKOR basierten Bilddatenbank
(https://senckenberg.klimt.uni-frankfurt.de/) und schaffen so eine
essentielle Grundlage zur gezielten Erforschung des Bestands. Ziel ist
es, diese Daten mittelfristig mit der im Rahmen des gleichfalls von der
Städel-Kooperationsprofessur am Kunstgeschichtlichen Institut
betriebenen Forschungs- und Ausstellungsprojekts „Die Welt im BILDnis.
Porträt, Sammler und Sammlungen von der Frühen Neuzeit bis zur
Aufklärung“ errichteten Datenbank zusammenzuführen
(https://holzhausen.klimt.uni-frankfurt.de/) und dadurch die
wissenschaftliche Bearbeitung der Frankfurter Sammelkultur vom 16. bis
zum 18. Jahrhundert mit der Bereitstellung eines entsprechenden
Forschungstools voranzutreiben.
Design und Programmierung der Datenbanken erfolgt durch Wendig OÜ (https://wendig.io)
(https://www.hirmerverlag.de/de/titel-2-2/die_portraetsammlung_der_dr_senckenbergischen_stiftung-2386/
)
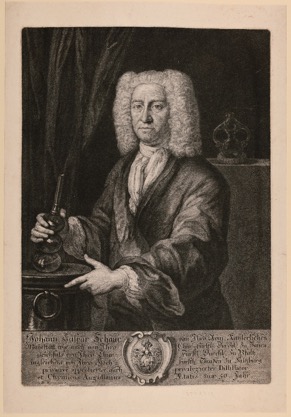
- Aktuelles und Presse
- Pressemitteilungen
- Öffentliche Veranstaltungen
- Uni-Publikationen
- Aktuelles Jahrbuch
- UniReport
- Forschung Frankfurt
- Aktuelle Stellenangebote
- Frankfurter Kinder-Uni
- Internationales
- Outgoings
- Erasmus / LLP
- Goethe Welcome Centre (GWC)
- Refugees / Geflüchtete
- Erasmus +
- Sprachenzentrum oder Fremdsprachen
- Goethe Research Academy for Early Career Researchers
- Forschung
- Research Support
- Forschungsprojekte, Kooperationen, Infrastruktur
- Profilbereich Molecular & Translational Medicine
- Profilbereich Structure & Dynamics of Life
- Profilbereich Space, Time & Matter
- Profilbereich Sustainability & Biodiversity
- Profilbereich Orders & Transformations
- Profilbereich Universality & Diversity